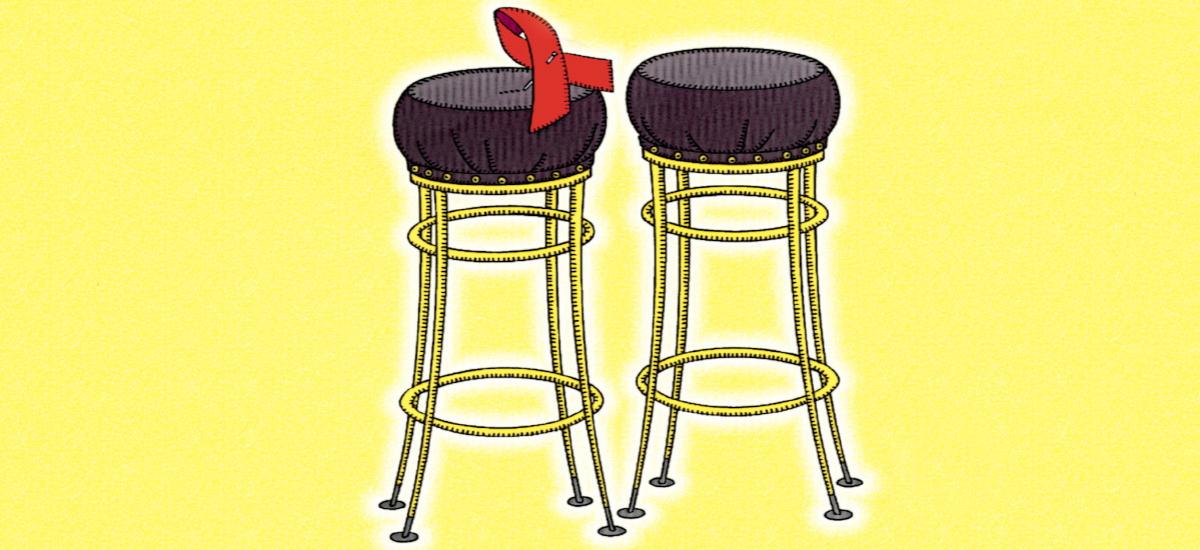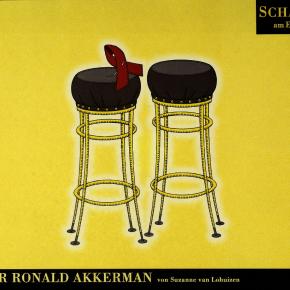Haupt-Reiter
Dossier: Ronald Akkerman
Deutsch von Jochen Neuhaus
Regie
Peer Boysen
Es spielen
Matthias Friedrich, Sabine Zeininger
Nächste Termine
Zum Stück
AIDS geht uns alle an. Auch wenn Deutschland im europäischen Vergleich die günstigste AIDS - Epidemilogie verzeichnet, gibt es immer noch vermeidbare Infektionen, sowie große Lücken in der Versorgung und Betreuung schwerstkranker Menschen – und es gibt auch weiterhin Aufklärungs- und Solidaritätsbedarf.
Das Theaterstück DOSSIER: RONALD AKKERMAN ist kein AIDS-Aufklärungsstück. Es ist mehr. Es geht um zwei Menschen und um ihre Beziehung angesichts einer tödlichen Krankheit. Für den aidskranken Ronals Akkerman verändert sich zwangsläufig alles, die Krankheit bestimmt in radikaler Form sein weiteres Leben. Die Krankenpflegerin Judith versucht sich der Nähe dieser Abhängigkeitsbeziehung zu entziehen, doch muß sie sich angesichts des Todes dem Leben stellen. Der Tod setzt der konfliktreichen Beziehung ein Ende, ohne dass die beiden zu einer Aussprache, zu einer Lösung finden – vielleicht gibt es auch keine Lösung.
Die Autorin Suzanne von Lohuizen stellt in dem Stück zwei Realitäten nebeneinander. Der gestorbene Ronald Akkerman trifft auf Judith; sie durchlaufen noch einmal ihre gemeinsame Zeit.
Der Regisseur Peer Boysen hat DOSSIER: RONALD AKKERMAN in unserem Theatercafé inszeniert, und es wird nur abends gespielt. Wir wollten bewusst das Stück nicht auf einer Theaterbühne ausstellen, sondern haben uns für eine intime Caféatmosphäre entschieden.
Auf unseren Wunsch hin wird die Münchner Aids-Hilfe versuchen, mit einer Kontaktperson präsent zu sein, um nach der Vorstellung interessierte Zuschauern mit fachlichen Informationen zur Seite zu stehen.
10 Jahre Münchner Aids-Hilfe - von Thomas Niederbühl
Im Januar 1984 wurde die Münchner AIDS-Hilfe e.V. als erste regionale Aids-Hilfe von schwulen Männern ins Leben gerufen. Der Wille, etwas gegen AIDS als reale Krankheit und als gesellschaftliche Herausforderung zu tun, mobilisierte die schwule Selbsthilfe. Zu den schwulen Männern kamen Junkies und Frauen, und es entstand ein Fach- und Interessenverband, der seinen unverzichtbaren Platz im Münchner Sozial- und Gesundheitswesen fand.
Unser Aufgabenspektrum wuchs in zehn Jahren zu einer umfassenden Infrastruktur aus ehrenamtlicher und hauptamtlicher Arbeit, aus Selbsthilfe und Servicefunktion: Selbsthilfe von Menschen mit HIV/AIDS, von Menschen aus den Betroffenengruppen, von nahestehenden aus dem sozialen Umfeld; Servicefunktion durch die Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle und durch das Pflege- und Servicezentrum sowohl in Aufbau und Unterstützung unserer Selbsthilfestrukturen als auch in Beratung, Betreuung und Pflege.
Doch neben der Infektionsverhütung, der Gesunderhaltung der Menschen mit HIV und der angemessenen Betreuung und Pflege im Krankheitsfall nehmen wir immer auch die Lebenswelten der Betroffenen und Bedrohten in den Blick: Stärkung der Identitäten, Verteidigung der unterschiedlichen Lebensstile, Entstigmatisierung und Entkriminalisierung, Vernetzung der Betroffenengruppen und parteiliches eintreten gegenüber Institutionen, Politik und Gesellschaft sind für uns selbstverständlich.
Blicken wir auf die bundesweite AIDS-Hilfebewegung, dann haben wir es geschafft, dass diese Vielfalt unserer Arbeit unter einem solidarischen dach geblieben ist. Das zeichnet uns als älteste regionale AIDS-Hilfe aus...In den zehn Jahren ist vieles erreicht worden. Was wir geleistet haben, kann sich sehen lassen. Auf unseren Lorbeeren können wir uns aber nicht ausruhen.
Wir müssen uns immer wieder den Herausforderungen stellen: Immer noch erkranken und sterben Menschen an AIDS. Immer noch werden AIDS-Kranke ausgegrenzt und diskriminiert. Immer noch droht Menschen mit HIV/AIDS soziale Verelendung. Mittelkürzungen im Gesundheits- und Sozialbereich, auch bei Menschen mit AIDS, auch bei AIDS-Hilfe, waren nie so aktuell. (...) Und es wird auch deutlich, dass wir wissen, worum es geht, wenn wir von AIDS reden und schreiben, wenn wir helfen und politisch arbeiten. Denn AIDS, das sind Menschen, auch Kranke, auch Tote, unsre FreundInnen, PartnerInnen und MitarbeiterInnen, das sind auch oft wir selbst.
(Thomas Niederbühl, Geschäftsführer der Münchner Aids-Hilfe e.V., Dezember 1993)
Die Taue sind gelöst - von Harold Brodkey
Sie beginnt im Schlaf, eine teils geträumte Erinnerung daran, jung zu sein und zum Leben eines jungen Mannes zu erwachen. Heute morgen habe ich mit Michael Jordan Basketball gespielt, und ich war so stark wie er, wenn nicht stärker. Welch ein Wust von Rollen, von personae sich doch einmischen, wenn man krank ist, neben der Abscheu vor sich selbst und dem Bedürfnis sich zu schützen, der immer wiederkehrenden Einfalt und Panik. Meine Identität gleicht einem Floß, umhergeworfen oder dahingleitend auf einem Strom von Gefühlen und Schrecken, darunter auch die morgendliche Illusion, (die manchmal zehn Minuten anhält), jung und heil zu sein. (...)
Die Prozession der Pillen: zwei Advil, eine 3TC, eine AZT, eine Paxil heute morgen und gestern Abend, als ich von Schweißausbrüchen durchweicht war, eine Behandlung mit Pentamidine. Die körperliche Schwäche und mein persönliches Gefühl von Unwissen lassen die schwarze Grube entstehen und erfüllen mich mit ungeduldiger Furcht. Die Nadel hat die Stelle des Kusses eingenommen. Der Tod und ich liegen in totalem Streit, Kopf an Kopf in klarer gegenseitiger Abneigung. Der Tod will niemanden haben, der begonnen hat, nach Arznei zu schmecken, aufgedunsen und konturlos ist...Der Aquisitionstrieb des Todes wird jedoch siegen. (...)
Es stört mich, dass ich das Ende des Jahrhunderts nicht mehr erleben werde – denn ich erinnere mich, dass ich, als ich jung war, zu meiner Adoptivschwester gesagt habe, so lange wollte ich leben: siebzig Jahre lang...Jedem hab ich die Frage gestellt – ich war vielleicht sechs oder sieben -, wirklich jedem, den Kindern in der Schule, den Lehrern, den Frauen in der Kantine, den Eltern anderer Kinder: Wie lange willst du leben? Ich nehme an, insgeheim lautete die Frage: Was macht dir Freude? Hast du Freude am Leben? Würdest du unter allen Umständen versuchen weiterzuleben? (...)
Ich fühle mich sehr gut, und irgendein mysteriöser Zyklus will es, dass ich mich schon eine Woche sehr glücklich fühle. Die Welt ist immer noch weit fort, scheint mir. Und jeden dahingleitenden Moment höre ich wispern. Und doch bin ich glücklich – sogar überdreht, geradezu närrisch. Es ist eine höchst seltsame Vorstellung, dass man den eigenen Tod genießen könnte. Ellen hat begonnen, über dieses Phänomen zu lachen. Wir sind grotesk, das wissen wir, aber was können wir daran ändern? Wir sind glücklich. (...)
Ich weiß keinen anderen Ort, an dem ich lieber stürbe als hier (in New York). Gern würde ich es im Bett tun und dabei aus meinem Fenster schauen. Ich finde den Ärger, das Unbehagen, die schwere physische und mentale Gefährdung hier interessanter als den Komfort irgendeines anderen Orts. Ich habe ein Bett auf einem hölzernen Podest – drei Stufen hoch -, und da liege ich, ans Fenster geschmiegt, von dem ich aus nach Midtown blicke mit einer changierenden Parade von Hochhäusern und Licht; vorbeifliegende Vögel werfen Schatten auf mich, auf mein Gesicht, meine Brust.
Ich kann die Vergangenheit nicht ändern und glaube, ich würde es auch nicht wollen. Ich erwarte nicht, dass man mich versteht. (...)
Man möchte noch Blicke auf das Wirkliche erhaschen. Gott ist etwas Unermessliches, während diese Krankheit, dieser Tod, der in mir steckt, dieses kleine, eng umrissene Ereignis, lediglich real ist, restlos, ohne ein Wunder zu bergen – oder eine Lehre. Ich stehe auf einem frei treibenden Floß, einem Kahn, der sich auf der biegsamen, fließenden Oberfläche eines Stromes bewegt. Es ist eine unsichtbare Situation. Ich weiß nicht, was ich tue. Die Unwissenheit, die angespannte Balance, die abrupten Stöße und die Instabilität breiten sich in kleinen, immer weitere Kreise ziehenden Wellen über meine sämtlichen Gedanken aus. Frieden?
Den hat es auf der Welt niemals gegeben. Doch auf dem geschmeidigen Wasser, unter dem Himmel, unverankert, reise ich nun dahin und höre mich lachen, zuerst aus Nervosität und dann vor echtem Staunen. Ich bin davon umgeben.
(Harold Brodkey, in: DIE ZEIT Nr. 6/2.Februar 1996)
Du weißt, was geschah. Aber weißt du, was es ist?
ER: Es war meine letzte Weihnacht
(...)
Wir taten so, als wäre ich überhaupt nicht krank.
Alle taten so.
Ich konnte mit Hilfe eines Stockes laufen.
Wir gingen zur Mitternachtsmesse
mit meinem vierjährigen Neffen Tjeerd.
Weihnachten im Schoß meiner Familie.
Wer hätte das gedacht?
Leo und ich fuhren immer zum Wintersport. Nichts, was ihn
so anwiderte, wie das pflichtschuldige Getue.
Ich fand es lustig. Ich hatte es nicht erwartet, aber ich fand es lustig.
Ich hatte für Tjeerd eine Kerze gekauft.
Einen Schneemann. Er freute sich darüber.
Beim Weihnachtsessen durfte er ihn anzünden.
Langsam sank er in sich zusammen.
Erst der Hut, dann die Augen.
Sie schmolzen und tropften herunter.
Schau, sagte Tjeerd, Der Schneemann weint, weil er stirbt.
Weinst du auch, Onkel Ronald?
Weil du stirbst?
Ich nahm ihn auf den Schoß. Ich sagte: Jawohl.
Manchmal muß ich darüber weinen.
Ich auch, sagt er.
Dann blies er schnell die Flamme aus.
Und dann haben wir alle gelacht.
(...)
SIE: Er hat dir den Schneemann aufs Grab gesetzt.
(Aus Dossier: Ronald Akkerman)